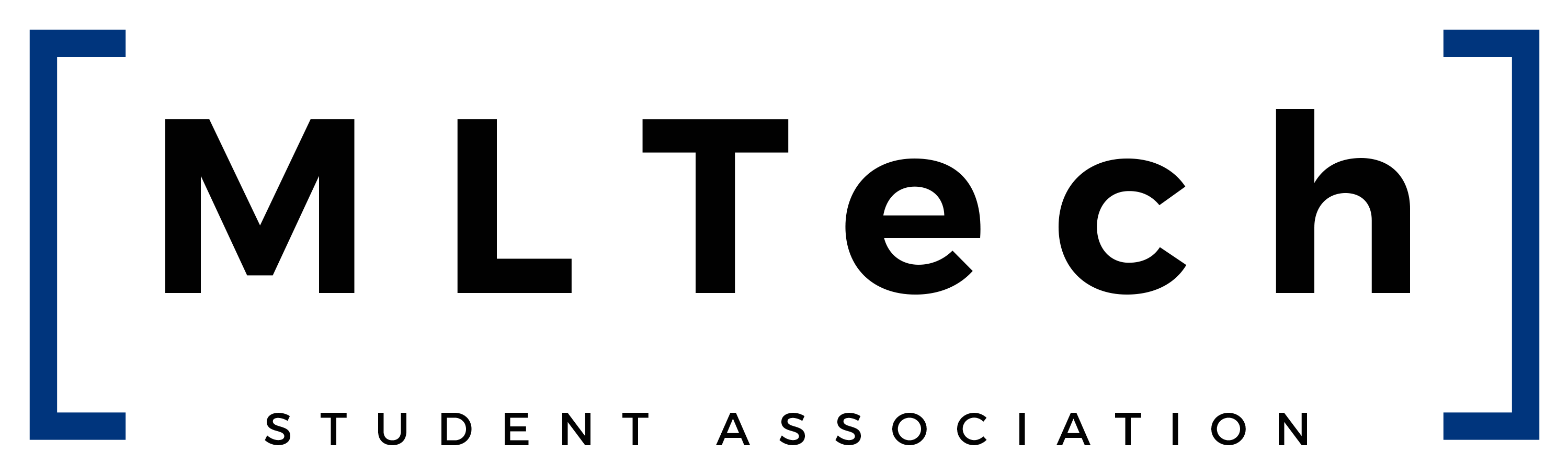Interview mit Frau Dr. iur. Ann-Kristin Mayrhofer und Herrn Dr. iur. Sebastian Dötterl
Während Künstliche Intelligenz und Tools wie ChatGPT oder der Beck-Chat in wissenschaftlichen Arbeiten oft kritisch betrachtet oder sogar untersagt werden, setzt das Grundlagenseminar „KI und Recht“ genau hier an – und fordert die Studierenden aktiv zur Nutzung solcher Technologien auf.
Das Seminar und seine Bedingungen
Bereits zum zweiten Mal in Folge bieten Frau Dr. Ann-Kristin Mayrhofer und Herr Dr. Sebastian Dötterl – Richter am Oberlandesgericht – das Grundlagenseminar „KI und Recht“ an. Ziel ist es, die Studierenden zur aktiven Nutzung von KI-Tools im Rahmen ihrer schriftlichen Arbeit zu verpflichten und ihnen so einen praxisnahen Umgang mit diesen Technologien zu vermitteln. Das bedeutet: Die Teilnehmenden sollen bewusst KI-gestützte Tools in ihrer Seminararbeit einsetzen und sich mit deren Hilfe juristischen Fragestellungen nähern. Das Motto lautet: „Learning by doing“ – allerdings unter einer entscheidenden Bedingung: absolute Transparenz. Die Studierenden sind verpflichtet, die Nutzung der Tools offen darzulegen und nachvollziehbar zu dokumentieren, welche Anwendungen sie verwendet haben und in welcher Weise diese in die Bearbeitung eingeflossen sind.
Ziel ist es, nicht nur die Potenziale, sondern auch die Grenzen künstlicher Intelligenz zu erkennen. So sollen die Studierenden sowohl die Vorteile der Technik kennenlernen als auch ein kritisches Bewusstsein für ihre Risiken und Schwächen entwickeln. Frau Dr. Mayrhofers und Herrn Dr. Dötterls zentrales Anliegen ist es, ein Bewusstsein für die Möglichkeiten und Gefahren von KI im juristischen Kontext zu schaffen und die Studierenden zum reflektierten Umgang mit den neuen Technologien zu befähigen. Denn: Nicht alles, was KI-Tools liefern, ist auch korrekt – die Teilnehmenden sollen lernen, nicht auf dem sprichwörtlichen Glatteis auszurutschen.
Das Seminar kann ohne Programmier- oder sonstige IT-Kenntnisse besucht werden.Die Zusammenarbeit zwischen Frau Dr. Mayrhofer und Herrn Dr. Dötterl ergab sich aus einem gemeinsamen Interesse an Digitalisierung und technischen Entwicklungen. Bereits 2023 veranstalteten sie ein Seminar zum Thema „Legal Tech in der Justiz“, in dem die Studierenden u.a. eigene Legal-Tech-Tool bauen mussten. Im Jahr 2024 wurde dann erstmals das Seminar „KI und Recht“ erfolgreich angeboten, bei dem ein aktiver Einsatz von KI-Tools durch die Studierenden gefordert war. Aufgrund des positiven Feedbacks entschlossen sich beide, es ein weiteres Mal durchzuführen. Der Ablauf blieb im Wesentlichen gleich. In Kooperation mit der Anwaltskanzlei Noerr wurde sowohl 2024 als auch 2025 eine Einführungsveranstaltung zur Nutzung von KI-Tools und zum „Legal Prompting“ veranstaltet. Auch das Legal Tech Colab wurde in beiden Jahren besucht. Eine bedeutende Neuerung 2025 ist die Kooperation mit dem Beck-Verlag – damit erhalten die Teilnehmenden Zugriff auf den Beck-Chat. Da dieser nun in allen Bereichen des Zivilrechts nutzbar ist, können die Studierenden deutlich umfangreicher recherchieren. Die Einführung in dieses Tool erfolgte durch Mitarbeitende des Beck-Verlags.
Die Rolle von KI in der juristischen Praxis
Das Seminar unterscheidet sich von anderen Formaten vor allem durch seine Zukunftsorientierung. Die fortschreitende Digitalisierung wirkt sich auf sämtliche Lebensbereiche aus – auch die Rechtswissenschaft ist davon nicht ausgenommen.
Auf die Frage, wie sich KI auf die juristische Arbeit auswirke, betont Frau Dr. Mayrhofer, dass – entgegen der oft geäußerten Befürchtung, KI könne den Anwaltsberuf ersetzen – ein Miteinander notwendig sei: Der Anwalt wird nicht ersetzt, sondern arbeitet künftig mit der KI.
Da juristische Chatbots bestimmte Aufgaben übernehmen, wird sich der Beruf allerdings verändern Es sind neue Kompetenzen gefragt – insbesondere die Fähigkeit, KI-generierte Inhalte kritisch zu prüfen. Auch die Ausbildung wird sich wandeln, da KI-Ergebnisse stets zu hinterfragen sind, was wiederum spezifische Fähigkeiten voraussetzt.
Hinzu kommen neue Regulierungen auf EU-Ebene, die komplexe Anforderungen mit sich bringen – und dadurch neue Berufsfelder entstehen lassen. Bereits jetzt zeigt sich ein Wandel in der Berufspraxis: Immer mehr Kanzleien stellen sogenannte Legal Engineers ein. Diese Entwicklung setzt jedoch eine reibungslose Kommunikation zwischen Juristinnen und Technikern voraus.
Mehr Möglichkeiten – aber auch mehr Verantwortung
Ob KI-Tools die juristische Arbeit für Studierende tatsächlich erleichtern, bleibt laut Frau Dr. Mayrhofer offen. Natürlich sei zu erwarten, dass immer mehr Tools zum Einsatz kommen. Die Recherche werde dadurch effizienter – so lasse sich etwa ein passendes BGH-Urteil zu einem Sachverhalt deutlich schneller finden. Doch die Kontrolle der Ergebnisse bleibt unerlässlich. Zudem könnte die Möglichkeit, bestimmte Aufgaben an die KI auszulagern, dazu führen, dass die erfolgreiche Bewältigung dieser Aufgaben mangels Eigenleistung in einer Haus- oder Seminararbeit weniger stark honoriert wird als bisher. Frau Dr. Mayrhofer bringt es auf den Punkt:
„Mit der Erweiterung der Möglichkeiten geht auch die Erhöhung der Anforderungen an Studierende einher.“
Ob sich dadurch eine tatsächliche Erleichterung im juristischen Studium ergibt, bezweifelt sie eher. Vielmehr stünden wir vor einem Wandel und neuen Herausforderungen. KI-Tools entwickeln sich fortlaufend weiter, ihre Funktionen und Potenziale wachsen stetig. OpenAI etwa hat in den vergangenen Monaten neue Sprachmodelle in ChatGPT integriert. So ist es inzwischen möglich, sich die zugrunde liegenden Quellen anzeigen zu lassen. Ein weiterer Vorteil: ChatGPT hebt relevante Passagen in Urteilen hervor, wodurch eine zeitaufwendige Lektüre des gesamten Urteils entfallen kann – es genügt, die markierte Passage auf ihre Richtigkeit zu überprüfen.
Dennoch gestaltet sich die Suche nach Primärquellen – etwa passenden Urteilen – weiterhin als schwierig, da der Zugriff auf Online-Datenbanken wie Juris oder Beck aktuell noch eingeschränkt ist. Vor diesem Hintergrund erscheint insbesondere die Übernahme des Softwareunternehmens Noxtua durch den Beck-Verlag als ein strategisch bedeutsamer Schritt. Die Verbindung von juristischem Fachverlagswissen mit technologischer Innovationskraft könnte künftig zu einer tiefgreifenden Weiterentwicklung digitaler Recherche- und Assistenzsysteme führen. Sollte es gelingen, KI-Tools direkt mit hochwertigen juristischen Inhalten aus Beck-Online zu verknüpfen, wäre ein deutlich produktiverer und gleichzeitig präziserer Umgang mit juristischen Quellen möglich.
KI als fester Bestandteil juristischer Ausbildung?
Um Studierende bereits frühzeitig mit diesen Entwicklungen vertraut zu machen, plädieren Frau Dr. Mayrhofer und Herr Dr. Dötterl dafür, die Nutzung von KI-Tools in Seminar- und Hausarbeiten zu erlauben. Den Studierenden sollte die Möglichkeit gegeben werden, den Umgang mit solchen Tools selbstständig zu erproben – und deren Grenzen zu erkennen. Dabei handelt es sich um einen fortlaufenden Lernprozess. Wer im Studium begleitet wird, macht im späteren Berufsleben weniger Fehler – und ist sich der Schwächen von KI besser bewusst. Für Lehrende folgt hieraus die neue – und nicht immer einfache – Aufgabe, die Studierenden bei diesem Lernprozess anzuleiten und zu unterstützen.
Mit ihrem Seminar gehen Frau Dr. Mayrhofer und Herr Dr. Dötterl genau diesen Schritt: Sie bereiten die Studierenden auf eine zunehmend digitalisierte juristische Arbeitswelt vor – und das mit einem gesunden Maß an Skepsis und Reflexion.
Wir danken Frau Dr. Mayrhofer und Herrn Dr. Dötterl herzlich für ihre Zeit und die spannenden Einblicke in ihr Seminar. Durch ihre engagierte Arbeit und ihr Gespür für aktuelle Entwicklungen schaffen sie es, die theoretische juristische Ausbildung um einen praxisnahen und zukunftsorientierten Zugang zu erweitern. Mit ihrer Expertise und Offenheit gegenüber technologischen Veränderungen leisten sie einen wichtigen Beitrag zur juristischen Ausbildung von morgen.
Über die Autorinen
Sarah Lisiecki (sarah.lisiecki@ml-tech.org) ist ehrenamtlich als Co-Head of Blog bei MLTech tätig und studiert Rechtswissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Rebecca Stürzer (rebecca.stuerzer@ml-tech.org) ist ehrenamtlich als Co-Head of Blog bei MLTech tätig und studiert Rechtswissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Über die Redakteure
Luis Hettrich (luis.hettrich@ml-tech.org) ist ehrenamtlich als Chief Editor bei MLTech tätig und studiert Rechtswissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Albert Hans Möller (albert.moeller@ml-tech.org) ist ehrenamtlich als Vorstand bei MLTech tätig und studiert Rechtswissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Allgemeine Anregungen oder Anfragen zum Blog gerne an: blog@ml-tech.org.